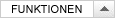Pressemitteilung
Der Markt ist die wichtigste Kulturleistung – Ablehnung des ergebnisoffenen Freihandels in Europa stark verbreitet
(PM) , 22.06.2006 - Bonn/Brüssel - Europas schreibende Zunft mokiert sich gerne über den Schöpfungsglauben, der wissenschaftlich verbrämt als Theorie des „intelligent design“ im US-amerikanischen „bible belt“ immer offensiver auftritt. Dabei helfen nicht wenige von ihnen eifrig mit, dass sich im alten Europa eine Mentalität breit macht, die letztlich ebenfalls auf einer Spielart des geschmähten „intelligent design“ beruht. Die Rede ist von der vor allem in Europa um sich greifenden Ablehnung des ungeplanten, ergebnisoffenen Freihandels und der ungebremsten Globalisierung der Märkte im Namen von sozialer Gerechtigkeit, Vorsorge und Nachhaltigkeit. Die Marktwirtschaft erscheint dabei als primitiv und moralisch minderwertig gegenüber auf angeblich „höherem“ Wissen beruhenden konstruktivistischen Ansätzen. Das „Vorsorgeprinzip“ nimmt heute im alten Europa offenbar den Platz ein, den in der theologisch begründeten vordarwinistischen Ökologie (Physico-Theologie) die göttliche Vorsehung (Providentia) innehatte.
Diese Propaganda fällt auf fruchtbaren Boden. Mehr als die Hälfte der Deutschen lehnt inzwischen die Marktwirtschaft ab. Fast drei Viertel der Franzosen sind sogar davon überzeugt, ihrem Land ginge es besser, wenn alle Beamte wären. Statt sich den neuen Herausforderungen zu stellen, flüchten sich immer mehr Menschen unter obrigkeitsstaatliche Bevormundung. Nur folkloristisch aufgemachte Wochen- und Jahrmärkte und von der Politik künstlich geschaffene Spielwiesen wie der Handel mit Treibhausgas-Emissionsrechten stehen in Europa noch relativ hoch im Kurs. Selbst in den USA finden protektionistische Bestrebungen immer mehr Anhänger.
Das lässt die Frage aufkommen, ob und wieweit die freie Marktwirtschaft überhaupt mit der menschlichen Natur vereinbar ist. Eng damit verbunden ist die Frage, wieweit es sich die Menschen heute noch leisten können, beim Management von Nahrungs-, Rohstoff-, Finanz- und Wissensressourcen auf die Leistungen des Marktes, auf den Wettbewerb als Entdeckungsverfahren zu verzichten. In den USA gehen unter anderen Leda Cosmides und John Tooby (Santa Barbara), die die Schule der der Evolutionären Psychologie (www.psych.ucsb.edu/research/cep/primer.html) begründet haben, diesen Fragen nach. Ihr Ansatz: Wenn das Schlagwort „eine Welt“ einen Sinn haben soll, muss man Psychologie, Soziologie oder Ökonomie bis zu einem gewissen Grade als Zweige der Biologie behandeln dürfen.
So untersucht die Evolutionäre Psychologie unter anderem, wie und unter welchen Voraussetzungen Kollektive zu intelligenteren Entscheidungen gelangen können als isolierte Individuen. Wir wissen schon lange, dass große Kollektive nicht unbedingt klüger entscheiden als Einzelne. Aus der Massenpsychologie von Gustave Le Bon ist uns seit mehr als einem Jahrhundert bekannt, dass Intelligenz, anstatt durch Kooperation zu wachsen, sich in amorphen Menschenmassen auch leicht verdünnen, verflüchtigen kann. Die moderne Hooligan-Forschung bestätigt: Ein Mob ist dümmer als das dümmste seiner Mitglieder. Viele Menschen zusammen sind nur unter bestimmten Bedingungen klüger als Einzelne.
Eine der historischen Voraussetzungen kluger kollektiver Entscheidungen ist die Bildung hierarchisch strukturierter Gemeinschaften, beginnend mit der Familie als Urzelle und deren Zusammenschluss zu einer Horde, die der geordneten Auswertung, dem Austausch und der Weitergabe von Erfahrungen über Generationen dienen. Etwa anderthalb Millionen Jahre lang lebten die Menschen als Jäger und Sammler in Horden mit höchstens 150 Mitgliedern, die von einem ausgeprägten Wir-Gefühl, einem Gruppenegoismus und einer damit verbundenen feindlichen Abgrenzung gegenüber konkurrierenden Horden zusammengehalten wurden. Die spezialisierten Schaltkreise unseres Hirns sind im Wesentlichen Anpassungen an die Lebensbedingungen solcher Horden. Sie sind darauf angelegt, Probleme zu lösen, mit denen solche kleinen Menschengruppen tagtäglich konfrontiert wurden.
Erst vor etwa 10.000 Jahren sind die Menschen infolge des Übergangs zu Ackerbau und Viehzucht, der sog. Neolitischen Revolution, zur Bildung größerer Gemeinschaften übergegangen. Die mit den neuen Techniken der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Kleidung erzielbaren (bescheidenen) Überschüsse ermöglichten die Gründung erster Städte mit Bewohnern, die nicht mehr darauf angewiesen waren, ihren Lebensunterhalt mit der Jagd oder der Landbewirtschaftung zu verdienen. Die Organisation des menschlichen Hirns konnte sich an diesen fundamentalen Wandel der Lebensbedingungen mithilfe des Wechselspiels von Mutation und Selektion aber bis heute kaum anpassen, weil der kurze Zeitraum von etwa 10.000 Jahren dafür nicht ausreichte. Auch wenn Hirnforscher und Paläontologen inzwischen zeigen konnten, dass sich das menschliche Hirn rascher fortentwickelt als bislang angenommen und in den letzten 10.000 Jahren tatsächlich einige neue Hirnleistungen wie vor allem die Perfektionierung sprachlicher Fertigkeiten hinzugekommen sind, gilt doch: Wir müssen uns in der modernen Welt mithilfe von Steinzeit-Hirnen zurechtfinden und durchschlagen.
Das menschliche Hirn ist nach wie vor nicht darauf angelegt, Probleme in Kollektiven zu lösen, die mehr als 150 Personen umfassen. Über die „magische Zahl“ 150, die einen Umschlagpunkt markiert, wurde in den letzten Jahren viel geschrieben. Ich erinnere hier nur an den Bestseller „The Tipping Point“ des amerikanischen Star-Journalisten Malcolm Gladwell (New York 2000). Die zum Beispiel der Sekte der Hutterer wohlbekannte Regel, Kollektive, die auf mehr als 150 Mitglieder anwachsen, am besten in zwei oder mehr relativ selbständige Gemeinden aufzuteilen, wird inzwischen auch von manchen im internationalen Konkurrenzkampf erfolgreichen Großkonzernen befolgt. Nicht zufällig übersteigt die Zahl der Einträge in den Adressbüchern durchschnittlicher Zeitgenossen selten die „magische Zahl“ von 150. Mehr Menschen kann kaum jemand zur gleichen Zeit persönlich kennen, einschätzen und in ihrer Entwicklung verfolgen.
Um Probleme in Kollektiven anzugehen, zu denen mehr als 150 Personen gehören, hat die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte im Prinzip nur zwei Methoden gefunden: den Markt und die Bürokratie. Der Markt als Methode, die Bedürfnisse und Wünsche vieler Menschen mit dem Wissen über deren Befriedigungsmöglichkeiten in Einklang zu bringen und so das Überleben größerer Kollektive zu sichern, ist historisch älter und auch deutlich erfolgreicher als die Bürokratie. Von Ausgrabungen wissen wir, dass schon die Menschen von Cro Magnon Arbeitsteilung und Fernhandel praktizierten, was es ihnen ermöglichte, die letzte Eiszeit zu überleben. Die zur gleichen Zeit in Europa noch lebenden körperlich stärkeren Neandertaler schafften das nicht, weil sie vermutlich die mentale Hürde zwischen dem rein persönlichen Austausch in der Horde und dem unpersönlichen Austausch auf dem großen Markt nicht überwinden konnten.
Das menschliche Hirn ist nämlich außerordentlich schlecht für den Markt gerüstet. In Form fest „verdrahteter“ Schaltkreise angelegte Instinkte wie der Gruppenegoismus, die Fixierung auf Hierarchien und der Futterneid, das heißt ein den nicht vermehrbaren Ressourcen der Jäger und Sammler entsprechendes Denken in Nullsummen, das nicht begreifen kann, dass beim Austausch von Gütern und Dienstleistungen Mehrwert und wirtschaftliches Wachstum entstehen können, erzeugen eine tief sitzende Aversion gegen Fremde und den Fernhandel mit ihnen. Deren Überwindung war wohl die erste und wichtigste Kulturleistung in der Menschheitsgeschichte. Erst durch das Ablegen der Scheu vor dem Fernhandel und dem unpersönlichen Austausch wurde Homo zum sapiens. Dieser unterscheidet sich - wie schon Friedrich August von Hayek, der Wirtschaftsnobelpreisträger von 1974, klar herausarbeitete - von seinen auf den persönlichen Austausch in der Horde beschränkten Vorgängern dadurch, dass er lernen muss, ständig in zwei verschiedenen Welten zu leben: in einem „warmen“, durch Familienbande zusammengehaltenen Mikrokosmos und in einem „kalten“ Makrokosmos, d.h. in der unpersönlichen, durch abstrakte Regeln geprägten Ordnung des Marktes. Es wäre wohl nicht politisch korrekt, aber durchaus nicht abwegig, alle Menschen, die diesen Sprung nicht geschafft haben, als Vormenschen zu bezeichnen.
Wir wissen nicht, ob unsere vorgeschichtlichen Ahnen von nackter Not zum Fernhandel getrieben wurden oder ob ihnen Mythen halfen, die Angst vor der Ungewissheit des unpersönlichen Austausches über größere Entfernungen zu überwinden. Vermutlich konnten die Menschen von Cro Magnon nur mithilfe religiöser Glaubenssätze, Symbole und Kulte Vertrauen in den unpersönlichen Markt fassen. Die von ihnen hinterlassenen Höhlenmalereien lassen das ahnen. Geholfen haben ihnen aber wohl auch bestimmte Hirnstrukturen, die sich im heutigen Leben besser bewähren als die zuvor erwähnten: So vor allem der Eigentums-Instinkt sowie die Fähigkeit zum Verstehen der Gefühle anderer mithilfe so genannter Spiegelneuronen und die damit zusammenhängende Bereitschaft zu selbstloser Hilfe oder zum Austausch mit Unbekannten zu beiderseitigem Vorteil.
Unterm Strich gibt es aber im menschlichen Hirn mehr Anlagen für das bürokratische Denken als Anlagen, die uns zum vernünftigen Handeln auf großen, unpersönlichen Märkten befähigen. Der Neid, verkleidet als Forderung nach Gleichbehandlung, erzeugt täglich aufs neue Misstrauen in das ergebnisoffene Wechselspiel von Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Obwohl die Menschheit höchstwahrscheinlich ihr Überleben der Arbeitsteilung und dem Freihandel verdankt, gaben die Menschen deshalb immer wieder der Versuchung nach, bürokratische Großorganisationen aufzubauen beziehungsweise diesen zu vertrauen, sofern ihnen überhaupt eine andere Wahl blieb, als sich mit bereits etablierten Machtstrukturen zu arrangieren.
Davon abgesehen, bleibt Bürokratie meines Erachtens ein notwendiges Übel, das auch die kühnsten radikal-liberalen beziehungsweise libertären Utopien von einer ausschließlich auf den Markt und das Privatrecht gegründeten menschlichen Gesellschaft nicht aus der Welt schaffen können. Denn dort braucht man zumindest Banken und Versicherungen mit privaten Sicherheitsdiensten, wenn nicht richtigen Armeen zur Einlösung von Schutzversprechen. Sowohl Versicherungen als auch Armeen sind aber bekanntlich bürokratische Organisationen par excellence. Auch für das Funktionieren von Märkten so wichtige Vorleistungen wie die kaufmännische Buchführung und das Erstellen von Statistiken sind nicht ohne bürokratische Formen des Managements denkbar. Die Bürokratie bleibt unser Schicksal.
Wir müssen uns aber davor hüten, bürokratische Problemlösungen zu glorifizieren, wenn nicht gar religiös aufzuladen. Die Annahme, mit Bürokratie allein könne man Frieden und Wohlstand schaffen, halte ich für einen gefährlichen Irrglauben. Denn jegliche aus dem Neid geborene bürokratische Großorganisation tendiert dazu, diesen aus der Steinzeit ererbten Reflex durch tägliche Übung zu verstärken. Das illustriert ein Blick auf unser bürokratisiertes Nachbarland Frankreich...
Um zu einem „ausgewogenen“ Verhältnis von Bürokratie und Markt zu gelangen, d.h. um sicher zu stellen, dass Neid und Anspruchsdenken bzw. Besitzstandsverteidigung nicht jegliche Innovation im Keim ersticken, müsste sich die Politik in erster Linie als Ordnungspolitik begreifen, die die Aufgabe hat, den jeder Bürokratie innewohnenden Drang zum eigengesetzlichen Ausufern zu bremsen und dafür zu sorgen, dass dem Ausprobieren neuer Ideen im freien Spiel von Versuch und Irrtum auf dem Markt genügend Raum bleibt. Das ist aber nicht möglich, wenn die Politik selbst vom Geist der Bürokratie durchdrungen ist.
Für eine Ausgeburt bürokratischen Hochmuts halte ich zum Beispiel die nun kurz vor der Verabschiedung stehende EU-Chemikalienverordnung REACh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Als ich vor fünf Jahren das vorbereitende „Weißbuch zur Chemikaliensicherheit“ sah, wurde ich unwillkürlich an die Geschichte vom Turmbau zu Babel im Alten Testament erinnert. Denn danach hätten die Hersteller, Verarbeiter und Anwender von Chemikalien Tests mit mehr als 40 Millionen Versuchstieren durchführen und etwa 100 Millionen Chemical Safety Reports (CSR) von jeweils bis zu 200 Seiten Umfang anfertigen müssen, um den neuen Vorschriften zu genügen. Wer hätte die lesen, verstehen und umsetzen sollen? Inzwischen ist am REACh-Entwurf, infolge zahlreicher Einsprüche durch erfahrene Praktiker der Industrie, sicher manches verbessert worden. Aber ich glaube noch immer nicht, dass das ehrgeizige Regelwerk ohne das Einräumen größerer Freiräume für marktwirtschaftliche Suchprozesse vor allem im Wissens- und Risikomanagement umgesetzt werden könnte.
Ich sehe gerade hinter solchen gut gemeinten, aber in der Praxis kaum umsetzbaren Regulierungsversuchen wie REACh den Anspruch eines „intelligent design“ durchschimmern. Man meint, von vornherein wissen zu können, was sich als nachhaltig erweisen wird. Aber nicht nur beim Wechselspiel von Angebot und Nachfrage auf dem Markt, sondern auch bei bürokratischen Problemlösungsversuchen kommt bekanntlich am Ende fast immer etwas heraus, das so niemand gewollt hat. Allerdings gibt es dabei in der Regel nur auf dem Markt angenehme Überraschungen, während die Ergebnisse bürokratischer Ansätze meistens enttäuschen.
Auf dem Markt geht es zwar zu wie in der natürlichen Evolution. Aber weil unser Hirn noch immer größtenteils an die Lebensbedingungen der Jäger und Sammler angepasst ist, erscheint es als wenig wahrscheinlich, dass wir bei Problemen des Ressourcen-, Risiko- und Wissensmanagements spontan marktwirtschaftliche Lösungswege einschlagen. Spontan entstehen, unter dem Druck der Not, allenfalls Schwarzmärkte, aber vermutlich keine nachhaltig lebensfähige marktwirtschaftliche Ordnung. Funktionsfähige Märkte bedürfen, so paradox das für manche auch klingen mag, der bewussten und planmäßigen Förderung wettbewerbsfreundlicher kultureller und rechtlicher Rahmenbedingungen.
Populistische Politiker haben in einer unübersichtlicher gewordenen Welt leichtes Spiel, weil sie sich auf das Fortwirken steinzeitlicher Reflexe in unseren Hirnen verlassen können. Sie bedienen sich beispielsweise der Urangst, der Himmel könne uns auf den Kopf fallen, wenn sie vor einer angeblich drohenden Klimakatastrophe warnen. So gelingt es ihnen bislang, den Ärger der (Öko-)Steuerzahler in Grenzen zu halten. Die so genannte Klimapolitik ist im Übrigen „intelligent design“ in Reinkultur. Denn sie geht davon aus, weltumspannende chaotische Prozesse durch Drehen an einer kleinen Stellschraube, dem technischen CO2-Ausstoß, in eine gewollte Richtung lenken zu können. Es war deshalb nur eine Frage der Zeit, dass die konservativen US-Evangelikalen das Thema „Global Warming“ und den Aberglauben der „Klimapolitik“ für sich entdeckten. Vielleicht sollte man ihnen dieses auch überlassen und nicht so tun, als sei „Klimapolitik“ mit den Idealen der europäischen Aufklärung vereinbar.
Der Aufbau einer nachhaltigen marktwirtschaftlichen Ordnung ist eine Kulturleistung, die gegen primitive Instinkte durchgesetzt werden muss. Das muss aber nicht die Form eines Kreuzzuges gegen den Bürokratismus annehmen. Es wäre schon viel gewonnen, wenn den Bürokraten klar gemacht würde, dass sie dem Markt zu dienen haben und nicht umgekehrt. Wir müssen dahin kommen, Menschen, die den Markt ablehnen, als unkultiviert dastehen zu lassen. Deshalb kommt der familiären und schulischen Erziehung eine zentrale Bedeutung zu: Sie muss den jungen Menschen Mut machen, Ungewissheiten auszuhalten und den Entdeckungsleistungen globalisierter Märkte zu vertrauen. Darin sehe ich die wichtigste Voraussetzung, um in der größer und schwerer überschaubar gewordenen Europäischen Union zu einer rationalen Bewertung der Risiken von Chemikalien und neuen Techniken zu gelangen.
Edgar Gärtner ist ausgebildeter Hydrobiologe und Fachjournalist für Chemie und Energie. Er leitet seit 2005 das Umweltforum des Centre for the New Europe (CNE), eines liberalen Think Tank in Brüssel.
PRESSEFACH 

Anzeige
PRESSEARCHIV 
Anzeige
BUSINESS-SERVICES 
Business Forum
Presseportal
PR-Welt
Branchenverzeichnis
PR-Dienstleisterverzeichnis
Kooperationsbörse
Presseportal
PR-Welt
Branchenverzeichnis
PR-Dienstleisterverzeichnis
Kooperationsbörse
Wissen und Praxis
Nachrichten
Fachartikel
Kolumnen
Interviews
Themenportale
Leitfäden
Mustervorlagen
Nachrichten
Fachartikel
Kolumnen
Interviews
Themenportale
Leitfäden
Mustervorlagen
© novo per motio KG