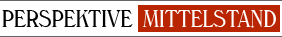Der Marburger Bund „geht baden“ – Der Streik der Unikliniken ist ein Argument für weitere Privatisierungen im Gesundheitswesen
(PM) , 12.06.2006 - Bonn/Berlin – Der Offizierssohn Frank Ulrich Montgomery tritt in die Fußstapfen des ehemals mächtigsten Gewerkschaftsführers der Bundesrepublik. Montgomery macht sozusagen den Kluncker, könnte man salopp formulieren. Heinz Kluncker ist der Mann, der die Brandt-Regierung zum Beben brachte. Der langjährige Vorsitzende der ehemaligen Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) trotzte der damaligen SPD/FDP-Bundesregierung Lohn- und Gehaltserhöhungen von elf Prozent für 1,4 Millionen Arbeiter und Angestellte bei Bund, Ländern und Gemeinden ab. Ursprünglich hatte der schwergewichtige Wuppertaler, der ein Kampfgewicht von 270 Pfund auf die Waage brachte, 15 Prozent angepeilt. Montgomerys Appetit ist noch ein wenig stärker. Er ist sozusagen „Mister 30 Prozent“. „Man hat uns ja längst 30 Prozent genommen. Die meisten Menschen wissen nicht, dass im Krankenhaus in den letzten zehn Jahren den Ärzten sieben Prozent Lohn genommen worden sind, während alle anderen sechs Prozent mehr bekommen haben. Das Weihnachtsgeld ist weggefallen. Das sind auch sieben Prozent. Jetzt sollen die Ärzte statt 38,5 Stunden 42 Stunden arbeiten - noch mal neun Prozent. Das sind genau die 30 Prozent, die wir fordern“, so begründete der Präsident des Ärzteverbandes Marburger Bund www.marburger-bund.de seine Forderungen. Die Patienten haben in Zeiten von Hartz IV immer weniger Verständnis für die Maximalansprüche der deutschen Universitätsklinikärzte. Die Gesetze der Marktwirtschaft könnten den „Patienten“ Marburger Bund kurieren. Bisher gelten sie nämlich nicht. Philipp Neumann schalt die Ärzte in der Tageszeitung Die Welt www.welt.de als „unflexibel“. Lösen ließe sich der Konflikt nur dann, wenn die Weißkittel und die Vertreter der Bundesländer – wie in der Wirtschaft längst üblich – mehr Flexibilität zulassen. „Es könnte mehr Geld für alle Ärzte geben, aber nicht überall gleich viel“, so Neumann, der dafür plädiert, dass die reichen Bundesländer mehr und die armen weniger Geld zahlen sollten. Zwischenzeitlich hatte Athanasios Drougias, der Sprecher des Medizinerverbandes, für Aufsehen gesorgt. Laut Netzeitung www.netzeitung.de hatte er gesagt, dass bei einem Streik an den Unikliniken die Katastrophenmedizin nicht angeboten werden könne: „Dann besteht die Gefahr, dass im Falle eines Anschlages oder einer anderen Katastrophe keine ausreichende medizinische Versorgung gewährleistet wird.“ Auf www.tagesschau.de räumte Drougias später ein, dass er sich bei diesen Aussagen „vergaloppiert“ habe. Während die Bürger Angst haben – ob begründet oder nicht – im Ernstfall medizinisch versorgt zu werden, gestalten sich die Streiks regelrecht idyllisch. So berichtet die Homepage des Marburger Bundes davon, dass man an der Uniklinik Bonn gemeinsam frühstücke, „unter besonderer Berücksichtigung etwaiger Touristen und japanischer Fußballnationalspieler“ durch die schöne Bonner Innenstadt flaniere und am Freitag im Melbbad – einem Freibad – baden gehen wolle. In Münster gab es einen Familientag im Zoo inklusive Elefantenfütterung. Der Besuch bei den „Dickhäutern“ ist wohl symbolisch zu verstehen. Nach Angaben der Bild-Zeitung www.bild.t-online.de mussten Krebs- und Bypass-Patienten derweil auf ihren Operationstermin warten. Auch wenn die Verschiebung eines Termins für eine Chemotherapie nicht direkt gesundheitsgefährdend ist, bleibt die psychische Belastung doch enorm. Während der Marburger Bund in diesem Kampf um „Macht und Eitelkeiten“ (Philipp Neumann) die Schlachten der siebziger Jahre schlägt, findet die Revolution in den Krankenhäusern schon längst statt. Wie die aktuelle Ausgabe der Wirtschaftswoche (Wiwo) www.wiwo.de berichtet, „vollzieht sich im Kliniksektor eine marktwirtschaftliche Revolution“. Die Privaten, so die Wiwo, setzen „bei den Sparoperationen das Skalpell in erster Linie bei den Personalkosten an“: „Sie organisieren den Arbeitsablauf so, dass sie mit wesentlich weniger Mitarbeitern auskommen. Die dort Beschäftigten verdienen dennoch nicht weniger als die Kollegen bei den öffentlichen Häusern. Schließlich zahlen Private meiste in Anlehnung an öffentliche Tarife.“ Unfreiwillige Schützenhilfe erhielten Helios, Rhön und Co. in diesen Tagen von der deutschen Ärzteschaft: „Der seit fast drei Monaten anhaltende Streik an den Landeskliniken und die damit verbundenen Einnahmeverluste dürften manchen öffentlichen Träger in seinen Verkaufsabsichten noch bestärken.“ Rund 80 Prozent der bundesweit 35 Unikliniken machten im Jahr 2004 Verluste. Schuld daran ist auch das Missmanagement – nicht nur in Universitätskliniken. „Ich erlebe fast überall in unserem Krankenhausbetrieb Veränderungsverweigerung. Nur ein Beispiel: Die Planungen für den einzelnen Patienten beginnen oft erst, wenn er eingeliefert wird. Vieles könnte aber vorab disponiert werden, um schneller und wirtschaftlicher zu sein“, sagte beispielsweise der Gesundheitsexperte Wolfram Candidus zum Rheinischen Merkur www.merkur.de. Letztlich tragen die Uni-Ärzte den Streik auf dem Rücken der Patienten aus, die sowieso für Gesundheit stärker zur Kasse gebeten werden. Zu Recht bestehen die Verhandlungsführer der Länder darauf, dass die Ärzte einen zuvor mit Verdi ausgehandelten Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst akzeptieren. Diesem Abschluss zufolge sollen Uni-Ärzte üppige 23 Prozent mehr verdienen. Wenn der Streik dennoch bedenkenlos weitergehen sollte, so ist dies ein Zeichen für Maßlosigkeit und Realitätsferne. Allerdings können sich auch die deutschen Unikliniken nicht dauerhaft von den Gesetzen der Marktwirtschaft abschotten. Letztlich könnte der Marburger Bund also „baden gehen“.
WEITERE MELDUNGEN DIESES AUTORS
27.08.2009 | Kreditklemme: Banken sitzen wieder am Spieltisch und der Mittelstand ...
http://perspektive-mittelstand.de/Kreditklemme-Banken-sitzen-wieder-am-Spieltisch-und-der-Mittelstand-verhungert-/pressemitteilung/21421.html
27.08.2009 | Verpackungsverordnung: Bundesländer wollen konsequenter
http://perspektive-mittelstand.de/Verpackungsverordnung-Bundeslaender-wollen-konsequenter-/pressemitteilung/21408.html
26.08.2009 | Studie: IT-Chefs auf Rollensuche – Wertbeitrag der Informationstechnologie ...
http://perspektive-mittelstand.de/Studie-IT-Chefs-auf-Rollensuche-Wertbeitrag-der-Informationstechnologie-fuer-den-Geschaeftserfolg/pressemitteilung/21361.html
20.08.2009 | Mittelstandsbilanz der Bundesregierung unzureichend - Deutschland braucht ...
http://perspektive-mittelstand.de/Mittelstandsbilanz-der-Bundesregierung-unzureichend-Deutschland-braucht-einen-neuen/pressemitteilung/21212.html
Link zum Pressefach des Autoren
http://perspektive-mittelstand.de/NeueNachricht/CorporateShowroom/Pressearchiv/59.html
Link zur Online-Version dieses Beitrags
http://perspektive-mittelstand.de/Der-Marburger-Bund-geht-baden-Der-Streik-der-Unikliniken-ist-ein-Argument-fuer-weitere/pressemitteilung/798.html